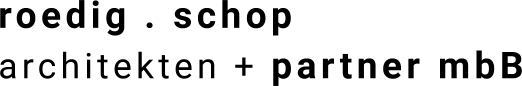Neuordnung des Moosacher St.-Martins-Platzes
mit Neubau Kultursaal und Azubiwohnen
städtebaulicher & freiraumplanerischer Wettbewerb
mit zaharias landschaftarchitekten
3.Preis
Entwurfskonzept
Der Neubau des Kultursaals schließt an der Ostseite des St.-Martins – Platzes den Raum und bildet zusammen mit dem Hacklhaus einen offenen, L-förmigen Hof zur Pelkovenstraße hin. Das Hacklhaus bleibt in seiner Grundsubstanz erhalten, die anschließenden Nebengebäude werden abgerissen, um Platz für den Anschluss an den Neubau zu schaffen.
Der neu geschaffene Kultursaal positioniert sich am östlichen Rand des bestehenden St. Martins Platzes. Durch seinen langestreckten schmalen Baukörper schafft er einen direkten Bezug zum Festplatz, ohne dabei den Platz in seiner zentralen Eigenschaft der Großzügigkeit zu entkräften. Durch den Erhalt einer möglichst großen Freifläche, lässt sich der Platz weiterhin flexibel für die verschiedenen Festlichkeiten rund um das Jahr nutzen. Der seitlich platzierte Neubau formuliert zudem eine klare städtebauliche Kante und sorgt so für die erforderliche Abgrenzung des St. Martins Platzes in Richtung benachbarter Wohnbebauung. Der neu gefasste Platz öffnet sich nun entschieden in Richtung Pelkovenstraße und wird damit seiner Funktion als Eingang zum historisch gewachsenen Dorfkernensembles gerecht.
In seiner Form fügt sich der Kultursaal durch das Aufgreifen der Gebäudehöhe und seinem Satteldach in die umliegende Bebauung ein. Das Hacklhaus wird auf seine ursprüngliche Form zurückgeschliffen und anschließend mit dem Kultursaal verbunden. Entlang des Festplatzes erstreckt sich ein längliches Foyer als zwischengesetzter Flachbau und zentral gelegener Verbindungsraum. Festplatz, Neubau, Hacklhaus und Garten werden funktional verbunden und lassen sich direkt von hier erreichen. Die verschiedenen Bereiche mit ihren ganz eigenen Qualitäten werden auf diese Weise zu einem facettenreichen Ganzen verbunden.
Direkt hinter dem Foyer befindet sich der bis unter das Dach reichende zweigeschossige Kultursaal. Der großzügig gestaltete Saalraum lässt sich für verschiedenste Veranstaltungen und Vorführungen nutzen. Die unmittelbar hinter der Bühne befindlichen Umkleiden ermöglichen einen direkten und barrierefreien Zugang zur Bühne.
Die Raumabfolge Festplatz, Foyer und Kultursaal lässt sich durch das Verschieben von Wand- und Fensterelementes Zusammenschalten und so als funktionale Verbindung von Innen und Außen nutzen. Im Falle des Maifestes lässt sich etwa das Festzelt direkt an das Foyer docken, wodurch sämtliche Infrastruktur (Toiletten/Küche/Lager/etc.) des Neubaus integriert und genutzt werden kann.In Richtung Pelkovenstraße bietet das Foyer den Besuchern mit seinem offenen Cafe in direkter Verbindung zur Küche ein attraktives Angebot, welches als Treffpunkt den Kultursaal entscheidend belebt.
Über den kompakten und bewusst einfach gehaltenen Erschließungskern zwischen Cafe und Saal lassen sich das OG und UG barrierefrei erreichen. Im Obergeschoss befindet sich die dem Saal angeschlossene Empore sowie die zur Straßenseite orientierten Büros. Ein Austritt in Richtung Festplatz führt die Besucher auf die über dem Foyer gelegene Dachterrasse. Während der Pausen können diese den St. Martinsplatz hier von oben betrachten.
Im Untergeschoss vermittelt ein großzügig gestalteter Flurbereich zwischen Haupttoilettenanlage, Tiefgarage sowie Lager- und Werkstattbereichen. Alternativ ist eine Verlängerung des Flures möglich, um eine direkte Verbindung zur U-Bahnstation zu schaffen.
Das Azubi Wohnen findet in einem kompakten Würfel förmigen Baukörper Platz, der als vier geschossiger Anbau an die südlich des Gartens gelegene Brandwand gesetzt wird. Der Zugang des Gebäudes erfolgt wie bei den Nachbargebäuden über die der Bockmeyerstraße zugewandte Seite. Ein Innenliegender Kern ermöglicht die vertikale Erschließung der um die Gebäudemitte angeordneten Wohnungen. Das Abstufen des Baukörpers auf Höhe des dritten Geschosses ermöglicht zum einen ein dichtes Heranrücken an die östliche Grundstücksgrenze, zum anderen schafft dieses den Platz für eine von den Azubis gemeinschaftlich nutzbare Dachterrasse.
Im Freiraumkonzept werden drei Plätze mit unterschiedlichem Charakter als Leitelemente gebildet, die durch den Hauptader des Wegesystems miteinander verbunden sind:
Der St.-Martins-Platz ist als Auftakt im Norden offen, befestigt, für multifunktionale Nutzungen geeignet. Mit seiner Ausstattung und umgebenden kulturellen und gemeinschaftlichen Nutzungen ist es das Entrée, Merkzeichen und Visitenkarte für das Areal.
Der Platz vor dem Pelkovenschlössl ist eine grüne Ruhezone mit Spiel- und Aufenthaltsbereich, ein Treffpunkt und Rückzugsbereich von dem intensiv genutzten und offenen St.-Martins-Platz.
Der Kirchplatz vor der neuen St. Martins-Kirche stellt den südlichen Abschluss und Entrée zu dem Areal dar. Seitlich an das Wegesystem angebunden, entsteht hier ein Raum mit dem aufgewerteten, offenen Kirchplatz und einem kleinen, schattigen Kirchgarten mit Sitznischen, Tischen zum Spielen und Speisen, kleine Feste nach Gottesdiensten. Der Platz eignet sich auch für einen Dult oder kirchliche Veranstaltungen im Freien.
Ein Nord-Süd und Ost-West-verlaufender Erschließungsweg verbindet die Plätze miteinander. Auch die umgebenden Rad- und Fußwegeverbindungen sowie die Grundschule werden durch diese Wegeführung zu einem Ganzen zusammengeführt.
Freiraumkonzept
Der St.-Martinsplatz wird durch das umgebende historische Ensemble definiert. Der Maßstab der räumlichen Fassung wird durch das Hacklhaus, und des im Blickbezug etwas im Hintergrund befindlichen Pelkovenschlössls angegeben. Im Westen, ebenfalls etwas zurückgetreten, die alte St.Martins-Kirche, mit dem Freidhof und Grünflächen mit parkartigem, altem Baumbestand, der auch die äußeren Ränder der Plätze mit einbezieht. Zwei Teppiche werden an den Plätzen ausgerollt: ein aus einem hochwertigen Pflasterbelag in der Mitte des St.Martins-Platzes, und eins als Garten vor dem Pelkovenschlössl. Ein einfacher, hochwertiger Belag aus ungerichtetem Mehrsteinsystem entlang der Fassaden und um der Platzmitte sowie an beiden Seiten der Pelkovenstraße fasst als Belag des Verbindungsweges das Gesamtareal zusammen. Der Teppich an den befestigten Plätzen wird durch Mischung von dunkleren Steinen in ähnlichen Formaten gewoben.
Der St.-Martins-Platz bleibt weitgehend unmöbliert, damit Raum für verschiedene Nutzungen wie Maifest, Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt, Veranstaltungen, frei bleibt. Das Festzelt kann in einer verkleinerten Form auf dem Platz aufgestellt und über Öffnungen in der Westfassade des neuen Kulturhauses mit dem Foyer verbunden werden. Am südlichen Platzrand sind Sitzbänke geplant. Den nördlichen Platzanschluss bildet eine lineare Fontäne, die im Sommer Kühlung bringt und den Platzraum hier fasst. Ein Café im Freien, betrieben aus den Räumen des Kultursaals, belebt den Platz. Als informelle Sitzmöglichkeiten werden mobile Stühle angeboten. Der Maibaum bleibt auf der gleichen Stelle erhalten.
Der Garten vor dem Pelkovenschlössl wird aufgewertet, mit klassischen Elementen eines kleinen Schlossgartens gestaltet. Der Kräutergarten mit Fontäne ergänzt das historische Bild des Pelkovenschlössls und belebt den Raum mit Duft und Farbe. Auf der erweiterten Erschließungszone an der Nordfassade können Tische und Sitzbänke für Veranstaltungen oder Pausenaufenthalt aufgestellt werden. Das Kriegerdenkmal bleibt erhalten- Auf der wassergebundenen Fläche um den Kräutergarten ist ein Spiel- und Aufenthaltsbereich mit Sitzbänken und Blick auf den Garten geplant, auch als Treffpunkt für die örtlichen Boulespieler. Die angrenzende, schattige Rasenfläche umschließt und verbindet die Platzräume.
Der Garten des Hacklhauses und des Studentenwohnheims bleibt parkartig gestaltet, mit dem alten Baumbestand. Eine Terrasse im Anschluss an die Südfassade mit Zugängen zum Hacklhaus und dem Foyer des Kultursaals dient den Nutzern als schattige, grüne Pausenfläche und steht optisch in Verbindung mit dem Garten des Studentenwohnheims. Bei größeren Veranstaltungen kann die Rasenfläche unter Bäumen mit beansprucht werden.
Der Platz vor der neuen St.-Martins-Kirche wird, analog zum nördlichen Platz, mit einem Teppich in der Mitte und Wegebelag um die Ränder in das Gesamtkonzept eingebunden. Am westlichen Rand, im Kirchgarten, werden durch Hecken und Stauden gegliederte Aufenthaltsräume mit Sitzgelegenheiten gebildet. Nördlich davon, auf der wegebegleitenden Grünfläche belebt die Spielwiese und Tischtennisplatten das Areal. Am östlichen Rand des Platzes spiegelt sich die Staudenpflanzung des Kirchengartens mit Sitzbänken im Bezug zum Platzraum.
Der das Areal verbindende, Nord-Süd-verlaufende Rad- und Fußweg wird mit einem einfachen Mehrsteinsystem gestaltet, der in allen Richtungen flächig wirkt. Diese Leitlinie umfasst die Plätze um die Fassaden herum und reicht bis zu den Wegen, die das Areal an die Umgebung anschließen. Auch der Vorbereich der Grundschule wird optisch über diesem Weg einbezogen.
Die Jenaer Straße wird als verkehrsberuhigte Wohn- und Spielstraße im Wettbewerbsabschnitt, zwischen Franz-Fils-Straße und Kreuzung zum Chemnitzer Platz und Leipziger Platz, gestaltet. Die Fahrbahn wird dafür an das Niveau des Fußweges und der Baumpflanzungen angehoben, sodass eine höhenmäßig ebene Fläche entsteht. Ein Belag mit Farbasphalt kennzeichnet das Areal, verlangsamt das Fahren und gibt Fussgängern und Radfahrern Priorität. Die Flächen vor der Kita und Schule werden dadurch zusammengefasst und bieten mehr Sicherheit für die Kinder.
Alle Flächen sind barrierefrei gestaltet.
Pflanzkonzept
Der alte Baumbestand bleibt erhalten und wird durch neue Baumpflanzungen ergänzt. Das Areal ist sehr gut begrünt und bedarf nur wenige ergänzende Baumpflanzungen. Als Auftakt im Norden zwischen Pelkovenstraße und dem neuen Kultursaal am St.-Martins-Platz wird ein neuer Baumhain als Schattenplatz geplant. Am südlichen Platzrand wird ebenfalls eine Baumreihe geplant. In dem Garten vor dem Pelkovenschlössl und auf der Spielwiese neben der neuen St. Martins Kirche werden noch einzelne Baumpflanzungen mit Klimabäumen, passend zum Bestand geplant.
Stadtklima, Klimaschutz, Klimaanpassung
Die Flächen werden nicht weiter, als im Bestand versiegelt. Im Norden haben wir einen urbaneren Bereich, mit mehr befestigten Flächen. Hier sind auch überwiegend die neuen Baumpflanzungen geplant. Die Baumgruben in befestigten Flächen werden als Baumrigolen mit Möglichkeit, Niederschlagswasser zu speichern, angelegt. Baumgruben in Grünflächen werden mit wasserspeichernden Substraten verfüllt. An der Wegeverbindung entlang der Bockmeyrstraße und der Jenaer Straße sowie südlich davon, um die neue St. Martins Kirche, ist bereits ein großer Baumbestand und weite Rasen- und Wiesenflächen vorhanden, welches positiv auf das Stadtklima auswirken.
Das Niederschlagswasser wird in den Vegetationsflächen gespeichert und teilweise verbraucht, versickert oder verdunstet. Oberflächenwasser von den befestigten Flächen wird nach Möglichkeit in die Grünflächen geleitet oder über rigolen an das Grundwasser versickert.